Realismen ohne Realität
Die Realität ist auch nicht mehr, was sie einmal war, und wenn es nach der Tech-Branche geht, ist das eine gute Sache. «Tauch ein in Welten mit einem neuen Realismus», versprach 2021 ein Werbeslogan auf der Website zur Playstation 5 von Sony; ein indirekter Hinweis darauf, dass sich der bisherige Realismus als so mangelhaft erwiesen haben muss, dass nur eine neue Spielekonsole für 399.— CHF Abhilfe schaffen kann. Was aber ist hier unter Realismus zu verstehen, und auf welche Weise kann er ‹neu› oder eben ‹alt› sein? Als moderne Spielekonsole erzeugt die Playstation Bilder und Klänge und daraus mitunter komplexe, dreidimensionale Umwelten – Realismus heisst folglich, dass wir diese Umwelten als audiovisuell überzeugende Abbilder einer Wirklichkeit wahrnehmen. Dabei ist Realismus eine Qualität des Abbilds, und nicht des Abgebildeten, wie die einer Spielsequenz entnommene Illustration hinter diesem Slogan zeigt: eine junge Frau in archaischer Kleidung schaut in ein Tal hinab, aus dessen dunstiger Tiefe sich sonderbar organische und dennoch industriell wirkende Formen erheben. So unrealistisch diese Szenerie selbst sein mag, so unmissverständlich bleibt, was an ihrer Darstellung realistisch sein soll – an der Frisur der Frau können wir jede Haarsträhne auseinanderhalten; die vielen unterschiedlichen Materialien ihrer Ausstattung – Pelze, Leder, Gewebe, Federn – sind präzise modelliert und schimmern im Sonnenlicht wie die Haut an ihren Armen und Wangen. Subtile atmosphärische Effekte lassen die Landschaft vor ihr wirken, als blickten wir in ein majestätisches Bergpanorama wie vielleicht auf einem Foto von Ansel Adams.
Dass dieser Realismus ‹neu› ist, liesse sich durch einen Vergleich mit den Bildern aus älteren Videospielen schnell belegen. Die Branche ist seit gut dreissig Jahren darum bemüht, ihre Arbeit am ‹wie wirklich› erscheinenden Bild als Fortschrittsgeschichte zu erzählen. Wie jede Fortschrittsgeschichte ist diese durch Erfindungen und Durchbrüche strukturiert. Im Fall der Playstation 5 wird der Realismus ‹neu›, weil die Konsole im Gegensatz zum Vorgängermodell das sogenannte ‹Raytracing› beherrscht, eine Methode, mit der – so die Website – «Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5-Spielen zu erzeugen». Wenn sich in einem aktuellen Spiel wie Control zwischen glänzenden Kunststeinböden, polierten Holzvertäfelungen und Glastüren die gesamte Welt in sich selbst zu spiegeln scheint, hat die Software dank Raytracing den Weg und die Brechungen von Lichtstrahlen an unterschiedlichen Materialoberflächen im Raum nachvollzogen. So ist gewissermassen eine virtuelle Photographie entstanden, die dann als tatsächliches Lichtbild auf dem Monitor aufscheint – bis zu mehrere Dutzend Mal pro Sekunde aktualisiert, um die Illusion von Bewegung zu erzeugen.
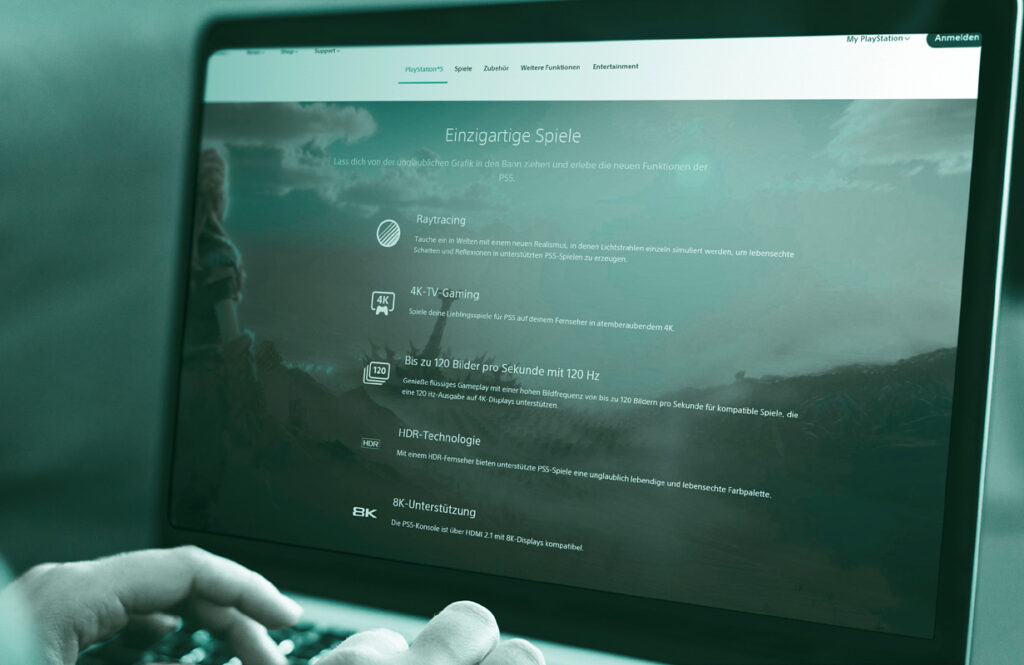
Raytracing in Echtzeit ist ein gutes, wenngleich streng genommen ahistorisches Beispiel dafür, warum wir überhaupt von ‹virtueller Realität› sprechen können. In der Popkultur war VR im Sinne einer technisch erzeugten, ganzheitlich erlebten Umwelt bereits Thema, als Raytracing nicht einmal als Konzept angedacht war; das Holodeck in Star Trek war einfach nur ein weiteres, analoges Filmset, und Raytracing in diesen Jahren etwas, wofür man über Nacht den Computer rechnen liess, um am nächsten Morgen am Monitor die fotorealistischen Spiegelungen von Schachbrettmustern und Marmorsäulen auf Chromkugeln bestaunen zu können. Wenngleich wir heute noch einen klobigen VR-Helm brauchen, um 3D-Welten wie VRChat oder Horizon auch sinnlich in allen drei Dimensionen zu erleben, finden Technologie und Tech-Vision langsam zusammen – am Set der Serie The Mandalorian kommt beispielsweise die Spiele-Software Unreal Engine zum Einsatz, um in Echtzeit die fantastischen Landschaften des Star-Wars-Universums zu generieren.

Methoden wie Raytracing simulieren physikalische Prozesse, damit wir digital erzeugte Bilder und Klänge als ‹wie wirklich› wahrnehmen. Sie lösen damit das Versprechen ein, dass sich virtuelle Realitäten mit technischen Mitteln erschaffen lassen. Was aber, wenn wir diese Bilder als ‹wie wirklich› wahrnehmen, gerade weil sie digital erzeugt sind? Unsere eigene Erfahrung scheint dagegenzusprechen – schliesslich ist es gerade der offenkundig hergestellte, berechnete Charakter, der selbst an den besten Simulationen unseren Widerwillen hervorruft und sie in das ‹Uncanny Valley› animierter Marionetten und Schaufensterpuppen verweist. Um dieses Argument weiterzuverfolgen, möchte ich zuerst die Entwicklung digitaler Bildwelten in einen weiteren historischen Zusammenhang stellen – denn weder ihre Struktur als Fortschrittserzählung noch unsere Sehnsucht nach immer neuen Realismen sind allzu neu. Tatsächlich fügen sie das digitale Bild nahtlos in die konventionelle kunsthistorische Erzählung ein, laut der sich die Geschichte visueller Darstellung anhand einer zielgerichteten Folge von Entdeckungen und Erfindungen beschreiben lässt: Die Renaissance entdeckt die Zentralperspektive; die Ölmalerei ermöglicht es, komplexe, brillante Farbkompositionen im Tafelbild haltbar und auf der Leinwand transportabel zu machen. Nachdem illusionistische Darstellungsweisen perfektioniert wurden, verlagert sich – inspiriert durch Fotografie und Psychologie – das Interesse hin zur subjektiven Wahrnehmung (Impressionismus) und den bildimmanenten Phänomenen von Form und Farbe (Kubismus und Abstraktion).
Die traditionelle Geschichte der Kunst ist so über weite Strecken auch eine Geschichte der Verwissenschaftlichung des Blicks, einer Dialektik zwischen der Analyse optischer Prinzipien und ihrer experimentellen Nachbildung in der Bildfläche. Dass das digitale Bild mit seinem neusten Anspruch auf Realismus jetzt anschliesst, wo die Malerei im 19ten Jahrhundert einen anderen Weg einschlug, erscheint nur folgerichtig – ist es doch durch seine Berechenbarkeit wie vorbestimmt für die Nachbildung natürlicher Gesetzmässigkeiten. So brauchen wir nicht länger auf der Leinwand zu experimentieren, wie ein Farbauftrag die Lichtreflexe auf Stoff, Stein oder Metall nachbilden könnte; dafür hat die 3D-Software ihre Algorithmen und Materialbibliotheken. Aus einer eher deterministischen Perspektive hiesse das, dass wir erst auf den Computer warten mussten, bevor das Projekt der realistischen Darstellung weiterbetrieben werden konnte; aus einer eher kritischen könnten wir uns fragen, ob es sich beim Streben nach dem neusten Realismus nicht doch um eine selbsterfüllende Prophezeiung handelt.
Als wäre ich wirklich im Spiel
Im Actionspiel Wolfenstein II – The New Colossus von 2017 findet der Protagonist B. J. Blazkowicz in der Kantine eines gekaperten U-Boots einen Spielautomaten. «Wow, diese Grafik wirkt äusserst realistisch », sagt der sonst eher schwer zu beeindruckende Blazkowicz, während auf dem Bildschirm altertümliche Pixelgrafiken laden, «als wäre ich wirklich im Spiel.» Diese kleine Szene ist ein Seitenhieb auf unsere sich stets wandelnde Erwartungshaltung an die überzeugende digitale Illusion – die Bilder, die Blazkowicz auf dem Spielautomaten sieht, wirken 2017 alles andere als «äusserst realistisch». Ihr Realismus ist derart veraltet, dass er vielmehr nostalgische Gefühle an die Frühzeit der 3D-Grafik aufruft – erst recht im direkten Vergleich zum fotorealistischen The New Colossus. Der Automat, vor dem Blazkowicz steht, heisst Wolfstone 3-D – eine unmissverständliche Anspielung auf Wolfenstein 3-D, einen frühen Vorläufer von The New Colossus, mit dem 1992 der bis heute anhaltende Boom für dreidimensionale Welten an PC oder Konsole begann. Als Spiel im Spiel ist Wolfstone 3-D ein Gimmick für Fans der Reihe und zugleich eine Zeitreise in die Vergangenheit der 3D-Grafik: Technisch, stilistisch, aber auch wahrnehmungspsychologisch, denn während Blazkowicz die Grafik bestaunt, staunen wir unsererseits, wie die monotonen Korridore und ruckelig animierten Pixelmännchen jemals als realistisch wahrgenommen werden konnten.

Was ist von einem solchen Staunen über das vergangene Staunen zu halten? In seinem zuerst 1959 erschienenen Buch Kunst und Illusion untersuchte Ernst Gombrich, wie die Arbeit an der überzeugenden visuellen Illusion die bildende Kunst seit der frühen Neuzeit bestimmte. Zumindest an der Dynamik der Erwartungen ans realistische Bild scheint sich dabei nichts geändert zu haben – bereits in Giovanni Boccaccios Mitte des 14ten Jahrhunderts verfasstem Il Decamerone findet sich eine Anekdote zum Maler Giotto; dieser sei mit so vorzüglichen Talenten begabt, dass die Natur
[…] nichts hervorbringt, was er mit Griffel, Feder oder Pinsel nicht dem Urbild so ähnlich darzustellen gewusst hätte, dass es nicht als ein Abbild, sondern als die Sache selbst erschienen wäre, weshalb denn der Gesichtssinn der Menschen nicht selten irregeleitet ward und für wirklich hielt, was nur gemalt war.1:
Es ist unwahrscheinlich, dass heute jemand ein Gemälde Giottos mit der Wirklichkeit verwechseln würde; hier hat der jeweils ‹ neue › Realismus von Da Vinci, Dürer, Raffael & Co. im Laufe der frühen Neuzeit die Erwartungshorizonte konsekutiv verändert. Erkenntnistheoretisch scheint dies vorerst irritierend, denn schliesslich hätte ein Blick weg vom Giotto oder vom Bildschirm mit Wolfenstein 3-D sofort klarstellen können, dass darauf nur wenig ‹wie wirklich› aussieht. Tatsächlich widerspricht gerade die kurze Halbwertszeit heutiger digitaler Realismen dem Fehlschluss, frühere Kulturen hätten aus mangelnder Einsicht ebenso mangelhafte Darstellungen akzeptiert – wer im 20ten Jahrhundert mit dem westlichen Kunstkanon und zumindest mit den Grundlagen der Geometrie als Bildungshintergrund aufgewachsen war, wäre laut einer solchen ‹ Modernisierungstheorie › des Blicks angesichts der defizitären Realismen der frühen digitalen 3D-Grafik kaum ins Staunen gekommen, sondern hätte sie sofort als unzureichend wirklichkeitsgetreu erkannt (der Autor kann das Gegenteil bezeugen). Gombrich bietet eine interessante Erklärung, für die er das klassische Beispiel des Wettstreits der Maler Zeuxis und Parrhasius heranzieht. Der von Plinius überlieferten Legende nach habe Zeuxis mit gemalten Trauben einige Vögel täuschen können, die an den zweidimensionalen Früchten zu picken begannen. Als Parrhasius daraufhin sein Gemälde präsentierte, griff Zeuxis sogleich nach dem Vorhang, der das Bild zu verbergen schien – nur um festzustellen, dass gerade dieser Vorhang eine perfekt gemalte Illusion war.

Gombrich zweifelt jedoch an, dass die Illusion dafür tatsächlich perfekt sein musste – Zeuxis hatte schlichtweg nicht erwartet, überhaupt mit einem gemalten Vorhang konfrontiert zu werden. Die Erwartungshaltung an die Illusion bleibt so an das jeweilige Medium gebunden. Wer dadurch getäuscht werden möchte, wird jeweils als «äusserst realistisch» erleben, was über die erwarteten Realitätseffekte hinausgeht – selbst wenn es als präzises Abbild im direkten Vergleich mit der Wirklichkeit kaum Bestand hätte.
Dies lässt uns mit der etwas ambivalenten Einsicht zurück, dass Menschen von Bildern getäuscht werden möchten, und relativiert zumindest in Bezug auf ihre Wahrnehmung die Ansprüche und Versprechen virtueller Realitäten – wer heute eine Playstation kauft (mehr zu dieser konkreten Handlung später), reiht sich einfach hinter Boccaccio in die Schlange ein, die seit vielen Jahrhunderten für den jeweils neusten Realismus ansteht.
Dennoch darf diese Kontinuität nicht die gewaltigen Unterschiede zwischen den verschiedenen ‹Realismen› nivellieren. Über eine VR-Brille den neusten Teil der Wolfenstein-Reihe zu spielen mag ein vergleichbares sinnlich-affektives Erlebnis unerwarteter Wirklichkeitsnähe bieten wie anno dazumal die Fresken Giottos für Boccaccio, doch ein Realismuseffekt wird in den meisten Fällen nicht der ausschliessliche Anlass für ein Kulturprodukt sein. Giotto gestaltet die Scrovegni-Kapelle im Auftrag eines vermögenden Bankiers und verwendet dafür das Bildprogramm der herrschenden christlichen Kirche; spätere Maler*innen beschäftigen sich mit illusionistischen Effekten, um die ästhetischen Bedingungen ihres Mediums zu reflektieren und eine individuelle künstlerische Praxis zu entwickeln. Die Wolfenstein-Spiele wurden in den 1990ern noch als technisch innovativer Actiontrash von einem winzigen Team hergestellt und vertrieben; die neuen Teile sind ambitioniert erzählte, polierte Grossproduktionen eines internationalen Konzerns – und damit wie The Mandalorian die Waren einer spätkapitalistischen Kulturindustrie, die gerade in ihrem Zusammenspiel mit der Tech-Branche heute industrieller geworden ist, als es sich Horkheimer und Adorno hätten vorstellen können.
Weltbilder in Bearbeitung
In den Produktionsbedingungen dieser unterschiedlichen ‹Realismen› wird ein weiterer Realitätsbezug sichtbar, der sich nicht auf die Simulation optischer Prozesse reduzieren lässt. Vielmehr geht es um die Frage, die historisch im ‹Realismus› als Gattung der Malerei und Literatur des 19ten Jahrhunderts aufgeworfen wurde: Wenn die künstlerischen Methoden der Darstellung zur Wirklichkeitstreue hinstreben, müsste dies nicht ebenso für die Inhalte gelten; müsste nicht jeweils das Leben als solches gezeigt werden, müssten nicht die realen gesellschaftspolitischen Verhältnisse dargestellt werden, selbst wenn ihre Subjekte und Motive für das Auge der herrschenden Klassen alles andere als repräsentativ erscheinen – wenn also Arbeit und Ausbeutung ihrerseits zu Bildinhalten werden und nicht nur Kapitalgrundlage einer Gesellschaft bleiben, in der das künstlerische Bild seinerseits den Herrschaftsanspruch von Eliten und seinen eigenen Wert als Luxusgut verfestigt? An diesem Moment finden der modernistische, wissenschaftliche Anspruch an die visuell korrekte Abbildung mit dem humanistischen, aufklärerischen Anspruch an gesellschaftlichen Fortschritt zusammen. Dass dies nicht identisch mit dem Erzeugen eines Realitätseffekts ist, liegt auf der Hand. Was ist von Giottos Fähigkeit zu halten, alles Natürliche «nicht als ein Abbild, sondern als die Sache selbst» darzustellen, wenn zumindest in der Scrovegni-Kapelle die meisten Motive anstelle der Natur der spätmittelalterlichen Bibelexegese entspringen? Auch aktuelle Videospiele und die VR-Visionen der grossen Konzerne bieten zumeist Realismen ohne Realität, Welten zur Weltflucht oder Tools, die den Gruppenchat in der Firma zum ‹Erlebnis› aufwerten sollen. Wie in den einschlägigen Science-Fiction-Dystopien füllen sie noch die letzte Zeit, die nicht mit Lohnarbeit verbracht wird. Ihre Realitätseffekte versprechen, dass dabei trotz aller Konsequenzlosigkeit wirklich etwas passiert – jeder Feierabend ein Erlebnisurlaub.
An seinen ideologischen Tiefpunkten wird der digitale Realismus nichts weiter als die eigene Wahrheit bezeugen – eine Sequenz im viel verlachten Metaverse-Video von 2021, in dem Facebooks Mark Zuckerberg und seine Mitarbeiter*innen die unterschiedlichen Anwendungsgebiete unserer vernetzten, virtuellen Zukunft vorstellen, ist dafür geradewegs allegorisch. Im Abschnitt zur ‹Bildung› erzählt Geschäftsführerin Marne Levine, wie wir uns dank Metaverse durch Raum und Zeit «teleportieren» werden können, um beispielsweise das antike Rom zu besuchen. «Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built», schwärmt Levine, während eine Metaverse-Nutzerin einen kleinen Regler in ihrem VR-Interface verschiebt und sich daraufhin vor ihr ein Triumphbogen aufbaut – Schicht um Schicht anhand eines digitalen Rasters, als würde die massive Konstruktion einfach durch einen 3D-Drucker ins Forum Romanum gezaubert. Was Levine als «tatsächlich sehen» beschreibt, macht die wirklichen, historischen Arbeitsprozesse unsichtbar – oder passt diese vielmehr an eine diffuse Vorstellung digitaler Arbeitsprozesse an, in der Dinge durch das Wischen übers Interface entstehen (selbst das verbirgt die Herstellungsbedingungen – der digitale Triumphbogen musste schliesslich anhand von Bildern des Originals modelliert, ausgeleuchtet usw. werden).
Wie an den anderen Abschnitten des Metaverse-Videos ist auch an dieser Präsentation nichts überzeugend – tatsächlich zeigen die meisten der Sequenzen darin nicht einmal Prototypen, sondern sind fingierte Darstellungen von VR-Ideen, die technisch möglicherweise gar nicht zu realisieren wären. Dennoch scheint das digitale Bild Gefahr zu laufen, von der erstaunlichen Illusion zum Beweis einer Wirklichkeit zu werden, die letztlich nur diejenige des digitalen Bilds selbst ist. Das hat einen ideologischen und einen ästhetischen Grund. Gerade die Verwissenschaftlichung des Bilds könnte zum Fehlschluss verleiten, das digitale Bild als objektiv zu betrachten – was berechnet wurde, ist zumindest nicht ausgedacht. Dieser Fehlschluss grassiert bereits in den Branchen, die sich mit Gesichtserkennung und dem sogenannten ‹Machine Learning› befassen. Ausser Acht bleibt dabei allzu oft, dass sowohl die verwendeten Datensätze wie Algorithmen bereits ein bestimmtes Weltbild reproduzieren und dann beispielsweise eine Software Schwarze als kriminell ‹identifiziert›, weil dies dem bereits rassistisch selektiven Datensatz entspricht – oder die Bildanalyse-Algorithmen schlichtweg auf hellhäutige Gesichter geeicht sind.
Zugleich müssen wir davon ausgehen, dass digital erzeugte Bilder in absehbarer Zukunft tatsächlich nicht länger als solche erkennbar sein werden. ‹Fotorealismus› wird dann zu einer gemeinsamen ästhetischen Qualität fotografisch aufgezeichneter und algorithmisch hergestellter Bilder, wobei das algorithmisch hergestellte Bild von der Fotografie die Aura des Dokumentarischen übernimmt. Was dies kulturell bedeuten wird, ist noch nicht abzuschätzen. Vielleicht wird es notwendig werden, konsequent den Glauben an den Bezug von Bildern zur materiellen Wirklichkeit zu verlernen; vielleicht wird eine übernächste Generation bereits ohne diesen Glauben aufwachsen – aber nicht ohne einen Glauben an die Bilder selbst, die, wie in Giottos Kapelle, schliesslich ohne wirkliche Referenz wirken können.
Wenn sich die perfekte Simulation visuell nicht länger von der Wirklichkeit unterscheiden lässt, ist sie kein Anlass zum Staunen mehr, sondern möglicherweise bereits normativ. Das kalifornische Unternehmen Nvidia, das seit den späten 1990ern den 3D-Boom in der Spielebranche mit passender Hardware unterfüttert, arbeitet heute an Methoden, in Echtzeit die Gesichter von Menschen in Telekonferenzen mit identischen 3D-Modellen zu ersetzen – so kann beispielsweise bei einer ungünstigen Kameraposition der Kopf automatisch in die richtige Richtung gedreht werden, um Augenkontakt mit den anderen Teilnehmer*innen zu halten; ein geplantes Tool namens Audio2Face soll Gesichter hingegen passend zu einer Tonspur animieren – vielleicht zur Sprachausgabe des automatischen Übersetzungstools, das selbstverständlich auch zu Nvidias Programmpaket gehört. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass VR durch solche Methoden schleichend im Alltag ankommen wird – nicht, weil die Menschen massenhaft in die drögen Schwundwelten Mark Zuckerbergs migrieren werden, sondern weil wir an irgendeinem Punkt merken, dass wir bereits die ganze Zeit als Avatare miteinander kommuniziert haben.
Genauer gesagt: die Realität wird so lange weiter ‹augmentiert›, bis sie sich nicht mehr von einer virtuellen Realität unterscheidet. Ob wir dafür eine VR-Brille aufsetzen, ist trivial, wenn ohnehin wesentliche Teile unserer visuellen Sphäre digital in Echtzeit erzeugt werden. Algorithmen in der Foto-App auf dem Smartphone greifen zunehmend ein, wie ein Bild entsteht; der ‹Magische Radierer› im neuen Pixel 6 von Google schlägt bereitwillig vor, welche störenden Bildinhalte entfernt werden könnten. Oder sollten? Bildmanipulation gehört seit Anbeginn zur Fotografie – neu ist hier, dass die Expertise dem Algorithmus überlassen wird, wie auch wir unsere Gesichter der Nvidia-Software überlassen sollen, um uns (?) in der Telekonferenz möglichst optimal zu präsentieren.
Damit könnte sich längerfristig ändern, was und wie wir sehen: Wenn wir alltäglich unsere volle Aufmerksamkeit auf Bilder einer optimierten Wirklichkeit richten, wird der Rest eventuell weniger wirklich, weil eben defizitär erscheinen. Selbstverständlich haben Hollywood und die Werbeindustrie ganze Generationen mit optimierten Bildwelten versorgt, doch war hier gerade die unerreichbare Ferne der Ideale massgeblich. Heutige digitale Methoden optimieren hingegen unsere Realität (beides schliesst einander freilich nicht aus: Ein naheliegendes Werkzeug wäre der digitale Flurspiegel, der uns virtuell einkleidet und nur auf die Bestätigung wartet, um die entsprechenden Produkte bei Zalando zu ordern). Was aber spielt sich in dem Abstand – oder bereits Abgrund – zwischen unseren beiden Wirklichkeiten ab?
Bisweilen ist von einer ‹Filter-Dysmorphie› die Rede, einer Entfremdung vom eigenen Körper, der nicht dem optimierten (Selbst-)Bild aus der App entspricht. Ob dies eine grössere gesellschaftliche Entwicklung ist oder kulturkritische Panik, ist schwer einzuschätzen. AR und VR könnten ganz im Gegenteil als Werkzeuge einer Selbstermächtigung über das eigene Bild dienen, und trotz algorithmischer Optimierung werden Körpernormen weiterhin zwischen Individuum und Gesellschaft ausgehandelt – was daran ‹realistisch› ist, bleibt entsprechend relativ. Gerade das perfekt gerenderte Antlitz der Computerspielheldin Aloy, die auf Sonys Website den ‹ neuen Realismus › der Playstation 5 verkörpern sollte, entsprach nicht jedermanns Wirklichkeitsvorstellungen – « kannst du mir erklären warum zur Hölle Aloy einen Bart hat », twitterte ein Spielefan angesichts eines Screenshots und meinte damit in szenetypisch maskuliner Ahnungslosigkeit den feinen Flaum an ihrer Wange; «gamer accidentally proves he has never been within 10 feet of a woman before», kommentierte jemand anderes trocken.2 Bereits in Anbetracht derart widersprüchlicher gesellschaftlicher Realitäten und Realismen bleibt so vorerst unentschieden, ob eine digitale Wirklichkeit eine Alternative oder die neue Norm, subversiv oder hegemonial wäre. Für letzteres spricht jedoch momentan, dass die Werkzeuge dazu von einer zunehmend kleinen Gruppe von Grosskonzernen entwickelt und zur Verfügung gestellt werden.
Illusionen am Ende
B. J. Blazkowiczs Staunen darüber, sich am Wolfstone-3-D-Automaten wie ‹wirklich im Spiel› zu fühlen, kann als sarkastische Fussnote zu dieser Diskussion verstanden werden. Die Zeitreise, die der ‹ alte › Realismus des Retro-Games ermöglicht, erweist sich angesichts der in The New Colossus erzählten Science-Fiction-Dystopie als weitaus prekärer: Blazkowiczs aktuellstes Abenteuer spielt nicht in unserer Gegenwart, sondern in den 1960ern einer alternativen Geschichte, in der Nazideutschland den Krieg gewonnen hat. Wenn wir mit Blazkowicz also am Wolfstone-3-D Automaten ein Spiel aus der Anfangszeit des 3D-Gaming spielen, ist dies ein doppelter Anachronismus – für uns eine Zeitreise in die frühen 90er, für Blazkowicz aber eine Zukunftstechnologie, die in den wirklichen 1960ern nicht realisierbar gewesen wäre. Zukunftstechnologie ist aber innerhalb dieser Story keine triviale Angelegenheit – in der Wolfenstein-Spielreihe sind gerade Futurismus und technischer Fortschritt Kennzeichen des faschistischen Apparats, gegen den Blazkowicz als Widerstandskämpfer aufbegehrt.
Dementsprechend ist auch Wolfstone 3-D ein innerhalb der alternativen Geschichte von The New Colossus durch die Nazis hergestelltes Zerrbild des Wolfenstein-Spiels, das in unserer Realität erst 1992 möglich werden würde – und Blazkowicz darin nicht länger der Held, sondern als ‹Terror-Billy› dessen Endgegner (ein technisch für die 1960er zeitgemässerer amerikanischer Flipper mit dem Slogan «Yes We Can» neben dem Wolfstone-Automaten ist, wenig überraschend, «Out of Order»). Dass Blazkowicz sich hier angesichts der realistischen Grafik fast ‹im Spiel› wähnt, ist ein entsprechend zwiespältiges Schicksal und nicht unbedingt eines, das man teilen möchte.
Es könnte sein, dass der künftige digitale Realismus ohnehin nicht an Menschen adressiert ist. Zu Nvidias Omniverse – einem umfassenden Soft- und Hardwarepaket für sämtliche 3D-Belange – gehört ein System, das die künstliche Intelligenz von selbstfahrenden Autos trainiert; aus Sicherheitsgründen und um der Effizienz willen nicht im realen Strassenverkehr, sondern in einer Simulation. Bei einer Tagung 2021 kündigte Nvidia-Chef Jensen Huang einen ‹digitalen Zwilling› unserer Welt an, der für alle denkbaren AR-, VR- und KI-Anwendungen zwischen Gaming, Videokonferenzen, Stadtplanung, Chirurgie und Robotik zur Verfügung stünde. Das ist weniger utopisch als pragmatisch gedacht – Daten sind Daten, und aus dem akkurat modellierten Fahrverhalten im spektakulären, fotorealistischen Rennspiel können sowohl die KI wie die Ingenieur*innen im Automobilunternehmen etwas lernen. Das ist ebenso nicht per se dystopisch – vielmehr wird es darauf ankommen, auf das Verhältnis zwischen unserer Welt und ihrem digitalen Zwilling zu achten, und welche davon effektiv anhand der anderen modelliert wird.
Es ist dennoch symptomatisch, wie viele der gerade populärsten und visuell aufwändigsten Videospiele der letzten Jahre ihrerseits dystopische Welten vorstellen. Auch für Aloy ist ein technoider «neuer Realismus» ein zwiespältiges Schicksal – Horizon Forbidden West, der unlängst erschienene neue Teil der Spielereihe um die junge Protagonistin, handelt von einer postapokalyptischen Welt, die menschlicher Hybris und destruktiver Maschinenherrschaft zum Opfer gefallen ist. Nach vielen Stunden mit dem ersten Teil gehe ich getrost davon aus, dass mich auch die schönen Illusionen von Horizon Forbidden West zum Staunen bringen würden; im Weg steht dem nur, dass die aktuelle Playstation noch anderthalb Jahre nach ihrer Markteinführung bestenfalls zu Wucherpreisen verfügbar ist – Lieferengpässe aufgrund der Covid-Pandemie, internationaler Handelskonflikte und Katastrophen verhindern die geplante Massenproduktion. Zu der kulturpessimistischen Einsicht, dass wir uns eher das Ende der Welt vorstellen können als das Ende des Kapitalismus, kommt heute also hinzu, dass wir eine Welt nach ihrem Ende fotorealistisch simulieren können – sofern es uns gelingt, in einer bereits desaströsen Gegenwart die dafür notwendige Hardware anzuschaffen.
| 1 | « […] ebbe uno ingegno di tanta eccellenzia, che niuna cosa dà la natura, madre di tutte le cose e operatrice col continuo girar de’ cieli, che egli con lo stile e con la penna o col pen- nello non dipignesse sí simile a quella, che non simile, anzi piú tosto dessa paresse, in tanto che molte volte nelle cose da lui fatte si truova che il visivo senso degli uomini vi prese er- rore, quello credendo esser vero che era dipinto. » |
|---|---|
| 2 | «Qenk podés explicarme porque carajos aloy tiene barba?», https://twitter.com/9Santy1/status/1493276073303457792 |